Fragen an Ingrid Arteel
- In Jelineks Privatroman Neid, jedenfalls in den ersten beiden Kapiteln, die bislang vorliegen, ist Sterben im Sinne auch von Abbauen, Leer-Werden, Dezimieren, ein zentrales Thema. Was alles für Aspekte und Facetten des Sterbens gibt es im Text?
- Welche Funktion kommt der „sterbenden“ Stadt bzw. der „sterbenden“ Gegend in den zwei ersten Kapiteln zu? Man hat ja fast das Gefühl, sie wären das eigentliche Hauptthema.
- Hat das Thema Tod/Sterben in Neid für Sie auch einen politischen Aspekt?
- Einige Bemerkungen in den ersten beiden Kapiteln lassen erkennen, dass die Ich-Erzählerin selbst eine Tote ist, jedenfalls eine, die die Lebenden beneidet. Wie sehen Sie das, und welche Erzähl-Perspektive ergibt sich daraus?
- Auch das Thema der Untoten, die nicht sterben können und immer wiederkehren müssen – ein zentrales Jelinek-Thema –, klingt in den ersten beiden Kapiteln an. Sehen Sie hier Bezüge zu früheren Jelinek-Texten?
- Auffällig sind in diesem Text immer wieder religiöse Anspielungen und Intertexte. Ist Jelinek katholisch geworden (oder war sie es vielleicht immer schon?), auch in Hinblick auf das Thema Tod und Sterben bzw. Wiederkehr der Toten?
(Die Fragen stellte Pia Janke)
Inge Arteels Antworten
Der Prozess des Sterbens, des Absterbens, des Ausgestorbenseins, steht tatsächlich an zentraler Stelle in den beiden schon vorliegenden Kapiteln.
Ich würde da (mindestens) zwei Bereiche unterscheiden, zunächst Tod und Sterben in Verbindung mit wirtschaftlicher Entwicklung, und zweitens die Ermordung von über 200 Juden während eines Todesmarsches 1945, also Tod im Zusammenhang mit Kriegsführung.
Ich lese die beiden Kapitel zunächst als Analyse und Kritik der wirtschaftlichen Modernisierung seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Obwohl die Zeit vor der Industrialisierung keineswegs verherrlicht wird, scheint doch eine graduelle Zunahme des Absterbens des Einzelnen im Arbeitsprozess der Moderne und des postindustriellen Zeitalters hervorgehoben zu werden. Die Produktionslogik der Industrie (hier konkret im Bergwerk) hat die Arbeiter ihrer Arbeit entfremdet. Jetzt, wo die ganze Industrie zu Ende gegangen ist, bleibt sozusagen ein Heer entfremdeter Arbeitsloser übrig. Dabei übt der Text durchaus auch Kritik an den sozialistischen Arbeitsbedingungen in der damaligen Industrie (es wird erwähnt, dass die Stadt damals „rot“ gewählt habe, Neid 1,18). Im „Heute“ des Textes befindet sich die Stadt in einer „Globalisierungsfalle“, die sich darin äußert, dass die Stadt in einen Tourismusort verwandelt werden soll, der sich vor allem auf „Dienstleistung“ konzentrieren soll. Dienstleistung als das Modewort, mit dem die Politik die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen versucht, das aber hauptsächlich virtuelle Arbeitsstellen und Bedürfnisse schafft (die neuen Arbeitsplätze werden „Leerstellen“ genannt, Neid 1,36; in der umgebauten Stadt sollten sich „künstliche Erlebniswelten“ auftun, Neid 1,80), stellt hier die nächste, aktuelle Stufe in der Entfremdung und Abtötung durch Arbeit dar.
Die Stadt kommt im Text tatsächlich als sterbende daher. Manchmal mutet das Bild wie eine Szenerie aus einem apokalyptischen Film an, wie eine Landschaft, aus der alles Menschliche verschwunden ist und wo nur noch leerstehende Wohnungen übrigbleiben. Ich lese diese Stadt als von dem Heer der gespenstischen Arbeitslosen bevölkert, die sich hier aber (wenigstens in diesen beiden Kapiteln), anders als zum Beispiel die geschichtsbeladenen Gespenster in Die Kinder der Toten, (noch?) nicht zu einem Rachezug organisieren.
In den Worten, mit denen die Umgestaltung der Stadt in Richtung eines virtuellen Tourismus- und Dienstleistungsort beschrieben wird, drückt sich meines Erachtens eine starke Kritik an heutigen biopolitischen Maßnahmen aus. ‚Biopolitik’ verwende ich hier in einer Foucaultschen Bedeutung der Disziplinierung von Körpern durch den Staat mittels wirtschaftlichen und technischen Maßnahmen. Die Verkleinerung und Sanierung (Neid 1,76), das Abbauen (Neid 1,79) der Stadt greifen in die Materialität, ja in die Körper der Menschen ein: „Alles, wo Menschen hineingepreßt werden, bzw. ihre Körperteile hineinzupressen wünschen, erweist sich immer als schwierig, da die Körper oft nicht passen.“ (Neid 1,78) Oder noch: „Man schichtet also die Menschen in andre Häuser um und reißt die, die leer geworden sind, ab, so wird die Stadt kleiner […]; sie werden zusammengefaltet und dann zusammengefaßt, aber das sind sie gewohnt, die Menschen“ (Neid 2,13). Die wirtschaftliche Entwicklung auf eine Dienstleistungsgesellschaft hin schafft den Menschen ab, braucht ihn nicht mehr.
Verbunden wird die Kritik an der Abtötung des Menschlichen in der Wirtschaft mit einer Kritik an der Kriegsführung seit 1914: „[…] seit 1914 ist ihr [der Menschen] Tod überhaupt Programm“ (Neid 1,62). Die im Rahmen der jeweiligen Kriege entwickelten Produktionstechniken schlagen sich in den Produktionsbedingungen in ‚Friedenszeiten’ nieder.
Tatsächlich siedelt sich die Ich-Erzählerin auf der Seite der Toten an. Einmal scheint sie sich sogar als Führerin des Arbeitslosenheers zu präsentieren (Neid 1,16).
Das wichtigste Merkmal der Erzählperspektive scheint mir hier ihre – durchaus explizit gemachte – Implikation, Verwicklung in die Virtualisierung, die andererseits von der Erzählstimme angeprangert wird. Poetologisch wichtig ist der Hinweis auf den virtuellen Charakter des Textes (denn nur im Netz zugänglich, und also jederzeit löschbar oder veränderbar), einen von der Erzählstimme durchaus erwünschten Zustand (vgl. Neid 1,51). Der Text wird so bewusst zum Teil der kritisierten virtuellen Marktlogik. Dennoch scheint die Erzählerin zugleich auch einen Widerstand gegen diese Marktlogik einzubauen: ihr Text ist zwar „für den raschen Verzehr“ gedacht, aber trotzdem „total ungenießbar“ (Neid 1,51). Dies dürfte als Strategie gelesen werden, die virtuelle Marktlogik mit den eigenen Mitteln wenn nicht zu bekämpfen, so doch wenigstens momentweise zu ‚stören’.
Das Ungenießbare des Textes äußert sich u.a. in dessen Widerstand gegen die Produktionslogik: der Text kommt nicht als fertiges und leicht konsumierbares, als „funktionierendes“ Produkt daher. Noch extremer als dies schon in Gier der Fall war, wird der Text von Kommentaren der Erzählstimme unterbrochen, die die vielfachen Wiederholungen und Abschweifungen, die abgebrochenen oder verlorenen Erzählfäden, den Gedächtnisverlust u.d.m. thematisieren. Ganz entschieden wehrt sich die Erzählstimme gegen kreatives Schöpfen: sie pfeift auf Kreativität und auf den damit verbundenen schöpferischen, gottesähnlichen Status (Neid 1,55) und begrüßt den Computer, der den Menschen in seiner Kreativität lähmt (ebd.). Auch hier wird die Verwicklung in die Virtualisierung und die Nicht-Authentizität durchaus als widerstandsfähiges Potential bejaht. Dieses Potential äußert sich in der Auffassung über Geschichte und Zeit der Ich-Erzählerin: Geschichte wird im Text als „eine Schleife“ aufgeführt, „die sich endlos wiederholt, nur anderswo, in einer anderen Dimension“ (Neid 1,14). Geschichte äußert sich nicht als lineare Entwicklung mit abschließbaren Epochen, sondern als Gleichzeitigkeit verschiedener Ebenen. Vergangene Ereignisse können daher nicht ‚weggeschmissen’, d.h. vergessen werden, sondern bleiben in der Schleife ‚aufgehoben’ (vgl. Neid 1,15). Das Schreiben der Ich-Erzählerin siedelt sich in der Perforation zwischen den Ebenen an, in den sogenannten „Wurmlöchern“, in denen sich die Gleichzeitigkeit der Geschichte realisiert, in denen die Untoten und Gespenster der Geschichte erscheinen. [Jelinek bezieht sich hier auf den Einsteins Relativitätstheorie entnommenen mathematisch-theoretischen Begriff der Wurmlöcher in der Astronomie. Wurmlöcher sind die – allerdings noch nicht belegten – Stellen im Kosmos, an denen die flache Welt zurückgebogen wird, sodass zwei Welten aufeinander liegen und die astronomischen Distanzen auf wenige Meter verkürzt werden. Ein Phänomen, das in manchem Science Fiction-Film eingesetzt wird.] So gestaltet sich das Schreiben als die äußerste Konsequenz der Virtualität, im Gegensatz zur Erinnerungspolitik der Posthistoire, die die Geschichte als ‚zu bewältigen’ und folglich ‚zu vergessen’ aus der Virtualität ausklammert. Als Beispiel davon wird im Text das „Gedenkprojekt der Schulen“ (Neid 1,24) in Bezug auf den Todesmarsch erwähnt, aus dem eine „lückenlose“ Dokumentation und ein „ganzes Denkmal“ hervorgehen: „Erinnerungsarbeit und aus.“ (Neid 1,25)
18. Mai 2007
Inge Arteel arbeitet als Oberassistentin für Forschung an der Vrije Universiteit Brüssel und ist Übersetzerin ins Niederländische von u.a. Jelinek und Mayröcker.
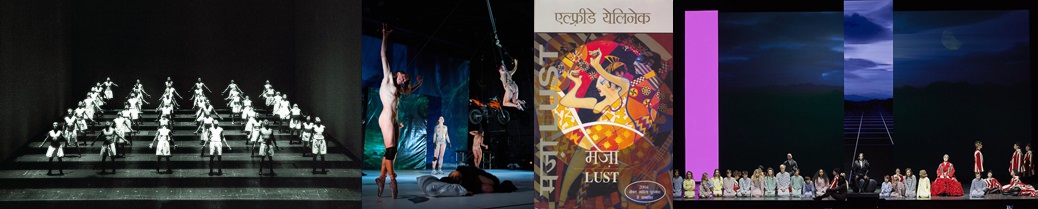

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.